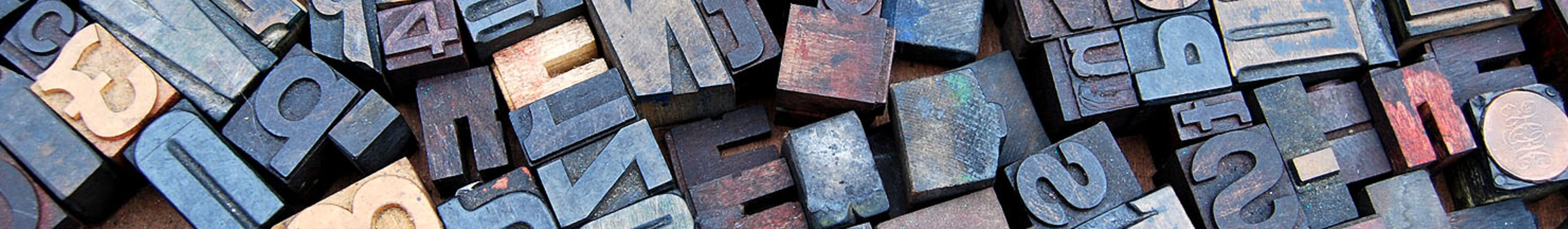18 Lehrkräfte nehmen aktuell an einer Seminarreihe „Gewaltfreie Kommunikation und Systemisches Denken im Schulalltag nutzen“ im Religionspädagogischen Institut Loccum (RPI) teil. Im Interview verraten Gottfried Orth, ehemaliger Professor für Evangelische Theologie und Religionspädagogik an der TU Braunschweig, und Bettina Wittmann-Stasch, RPI-Dozentin für Schulseelsorge, wieso Gewaltfreie Kommunikation und Systemisches Denken Lehrer*innen erstmal irritiert, was sich dadurch im Miteinander verändert – und wie beide selbst in ihrem theologischen Arbeiten davon geprägt sind.
Wie macht Gewaltfreie Kommunikation aus?
Orth: Am Anfang steht die Entscheidung: „Ich möchte mit jedem Menschen wertschätzend kommunizieren, auch mit denen, die ich nicht mag.“ Und wenn ich das für mich entschieden habe, dann beginnt die Arbeit an meiner Sprache und meinen Kommunikationsformen.
Wittmann-Stasch: Ich muss mir klar machen: Menschen sagen oder tun Dinge nicht, um andere zu ärgern. Sondern sie haben immer Gründe für das, was sie tun.
Sie sprechen im Zusammenhang von Gewaltfreier Kommunikation von Wolfs- und Giraffensprache. Was verbirgt sich denn dahinter?
Orth: Die Unterscheidung stammt von Marshall Rosenberg, dem Begründer der Gewaltfreien Kommunikation. Er würde sagen: Unsere normale Sprache ist eine Wolfssprache – da verhalten wir uns so, wie Wölfe das in Märchen tun: Wir sprechen, um als Gewinner vom Platz zu gehen. Dagegen setzt er die Giraffensprache. Die nennt Rosenberg deshalb so, weil die Giraffe das Landtier mit dem größten Herzen ist. Gewaltfreie Kommunikation ist, auch, wenn das vielleicht etwas pathetisch klingt, eine Kommunikation von Herz zu Herz. Ich bin neugierig auf das, was der oder die andere mir sagt.
Wie kann denn solche Kommunikation im schulischen Kontext aussehen?
Orth: Ich gehe davon aus, dass mein Gegenüber das, was er oder sie tut, aus positivem Antrieb tut. Das heißt auf den Schulalltag übertragen: Davon auszugehen, dass die Schüler*innen mir nichts Böses wollen, sondern dass sie nach ihren Bedürfnissen handeln. Auch ich äußere meine Bedürfnisse. Es geht also darum, gemeinsam in der Gruppe zu einer Lösung zu finden, die alle berücksichtigt.
Wittmann-Stasch: Hier in unserem Seminar in Loccum schauen wir uns dazu exemplarisch Einzelsituationen aus der Schule an und wir üben Haltung und Methoden Gewaltfreier Kommunikation wie Systemischen Denkens ein.
Orth: Gewaltfreie Kommunikation besteht aus vier Schritten. Man könnte auch sagen: Die Grammatik der Gewaltfreien Kommunikation umfasst vier wesentliche Aspekte: Zuerst geht es um Beobachtung. Ich beobachte und werte nicht. Dann geht es um mein Gefühl: Wie reagiere ich auf das, was ich da beobachtet habe? Dieses Gefühl verstehe ich dann als Hinweis auf meine Bedürfnisse, die erfüllt sind oder eben auch nicht - und so lerne ich letztendlich mich selbst ein Stück besser zu verstehen. Und als viertes formuliere ich eine Bitte an mich selbst oder mein Gegenüber, wie dieses Bedürfnis zukünftig erfüllt werden kann.
Das klingt etwas abstrakt, ehrlich gesagt.
Orth: Vielleicht hilft ein Beispiel: Ein Mädchen im 2. Schuljahr schreibt die Hausaufgaben in Schönschrift. Und als Lehrkraft sage ich, wenn ich Gewaltfreier Kommunikation anwende, z.B.: „Ich habe mich sehr gefreut, dass du die Hausaufgaben so schön geschrieben hast. Das hat es mir erleichtert, sie zu lesen. Das wollte ich dir heute unbedingt auch sagen.“ Das ist etwas anderes, als einfach zu loben und zu sagen: Hast du schön gemacht! Denn so ein Satz bindet das Kind ein in das schulische Konzept von Bewertung. Wenn die Lehrkraft aber sagt, was sie selbst dabei fühlt, macht das Mädchen eine Selbstwirksamkeitserfahrung.
In Ihrem Seminar verbinden Sie Gewaltfreie Kommunikation und Systemisches Denken. Wie passt denn beides zusammen?
Wittmann-Stasch: Beide Konzepte teilen das ehrliche Interesse am Gegenüber und die Grundeinsicht: „Ich bin nicht du“ – und ich weiß nicht besser als du selbst, was du denkst, was du fühlst und was du brauchst. Oder kurz: Jeder Mensch ist Experte seines eigenen Lebens.
Und wie wirkt es sich auf die Schüler*innen aus, wenn die Lehrkräfte so agieren?
Orth: Manche Kinder oder Jugendliche vermuten zuerst einen pädagogischen Trick. Sie denken, ich will mich als Lehrer damit schneller durchsetzen. Dabei geht es in beiden Ansätzen darum, dass Menschen sich selbst und andere besser verstehen.
Wittmann-Stasch: Wenn jemand so anfängt, verändert das in der Folge das ganze System. So wie ein Mobile sich jeweils neu ausrichtet, wenn ein Teil dazukommt oder wegfällt.
Orth: Die Teilnehmenden in unserem Seminar erzählen, dass sich auch ihre familiären Situationen durch diese Form der Kommunikation ändern. Denn tatsächlich kann man das überall anwenden!
Was hat sich denn bei Ihnen selbst durch diese Art zu denken geändert?
Orth: Bei uns beiden ist unser theologisches Arbeiten anders geworden! Wir haben gelernt, bei biblischen Texten nochmal anders hinzuschauen, was da eigentlich steht.
Wittmann-Stasch: Bei der Heilung des Bartimäus sehen wir beide von unseren Grundhal-tungen aus: Jesus fragt den Blinden, was er für ihn tun soll – verrückt eigentlich. Müsste das nicht klar sein?
Orth: Er achtet damit die Autonomie des Blinden. Oder bei Zachäus, dem Zöllner auf dem Baum: Jesus wertet nicht, was er getan hat. Stattdessen stellt er ihm einen Raum zur Verfügung, in dem er sich ändern kann.
Wittmann-Stasch: Im übertragenen Sinn ist das auch die Zielrichtung und Quintessenz unserer Arbeit: Anderen einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem Neues möglich wird.
Die Fragen stellte Michaela Veit-Engelmann für das RPI Loccum.
Foto: Michaela Veit-Engelmann